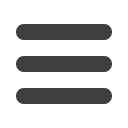

05
T H EMA
sich aufgrund einer (geistigen) Behinderung nicht oder
kaum mitteilen können. Die Stiftung skizziert einige Lö-
sungswege, wie das gelingen kann, etwa Herbeizie-
hung von Zeugen, Unterlagen, Erkenntnissen. Ehrli-
cherweise sind aber auch Gefahren oder Fallstricke
denkbar. Wir sollten z. B. niemandem eine Betroffen-
heit unterstellen oder einreden, die gar nicht da ist. Wir
möchten Betroffenen und ihren Bevollmächtigten emp-
fehlen, Kontakt zu uns aufzunehmen, damit wir dann
gemeinsam das Weitere beraten und prüfen können.
Zahlen
Wie viele Personen haben sich bei uns ange-
meldet?
Es haben sich ab April 2017 zunächst deutlich weniger
Menschen bei uns gemeldet, als wir erwartet hätten.
Den meisten anderen Anlaufstellen ging es ähnlich.
Anfangs hatten wir rund 10 Anmeldungen im Monat.
Dann sind die Zahlen kontinuierlich gestiegen, auf 20
im Aug. und Sep. auf 30 im Okt. bis Dez. und auf über
50 seit Januar 2018. Bislang haben sich 370 Damen
und Herren bei uns gemeldet, die meisten (aber nicht
alle) haben auch Zugang zu den finanziellen Leistun-
gen der Stiftung. Momentan überwiegen in Bayern
deutlich Betroffene, die in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe untergebracht waren. Betroffene, die in Ein-
richtungen der Psychiatrie waren, haben wir noch nicht
viele bei uns. Ich glaube, diesen Teil der Zielgruppe ha-
ben wir noch nicht erreicht. In Bayern haben sich über-
durchschnittlich viele gehörlose Menschen gemeldet.
Rund 125 Damen und Herren haben bereits finanzielle
Leistungen der Stiftung erhalten, die Summe der aus-
gezahlten Leistungen an Betroffene in Bayern beträgt
derzeit rund 1,25 Mio. Euro.
Was berichten uns die Menschen?
Im Mittelpunkt stehen Schilderungen von körperlicher
Gewalterfahrung. Es gab Schläge, oft mit Gegenstän-
den wie Stöcken. Gehörlose Menschen wurden ge-
schlagen, wenn sie ihre Gebärdensprache verwenden
wollten und das nicht tun sollten. Viele berichten, dass
sie oft gar nicht verstehen konnten, weshalb sie schon
wieder geschlagen worden sind. Das Schlimme an den
Schlägen, Kopfnüssen usw. war, dass daraus ein Ge-
fühl der Erniedrigung entstanden ist. Das Gefühl, aus-
geliefert und hilflos zu sein. Die Gewalt war unbe-
rechenbar und erschien willkürlich. Es wurde dem Jun-
gen oder dem Mädchen eingeprügelt, nicht gut, nicht
in Ordnung zu sein, so wie er oder sie es war. Dieses
Gefühl ist oft heute noch da.
Ein zweiter Schwerpunkt (der Schilderungen) bezieht
sich auf Essen, Trinken, Ernährung. Essen als Druck-
mittel und Strafe für alles und jeden. Essen als Zwang,
verweigertes Essen. Der Zwang, Erbrochenes zu essen.
Ein dritter Schwerpunkt ist (die Schilderung), dass sich
viele Betroffene nicht gut gefördert gefühlt haben. Wei-
ter gefasst: Viele haben sich emotional nicht gut ange-
nommen und aufgehoben gefühlt.
Betroffene berichten uns davon, dass sie eingesperrt
worden sind. Sie deuten an, sexualisierte Gewalt erfah-
ren zu haben. Sie sagen, dass Freundschaften und So-
lidarität in der Einrichtung unterbunden worden sind.
Die Aufnahme in die Einrichtung war für viele trauma-
tisch, weil sie gar nicht wussten, wo sie überhaupt hin-
kommen und wie lange sie bleiben werden. Die Situa-
tion von Mädchen und Jungen, die nachts ins Bett ge-
macht haben, war besonders schwierig. Stigmatisie-
rung, Strafen, Schläge, kein Trinken mehr ab dem Nach-
mittag. Die Angst dieser Kinder wurde immer stärker.
Suchten die Kinder und Jugendlichen ausnahmsweise
Hilfe, wurde ihnen nicht geglaubt.
Wie kann Aufarbeitung gelingen?
Öffentlichkeitsarbeit
Wie Heiner Keupp so anschaulich ausgeführt hat, ist
Voraussetzung für Aufarbeitung, dass die Erfahrungen
der Betroffenen und die Folgen daraus zur Sprache
kommen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Betroffenen über-
haupt erst von den Angeboten und Leistungen der Stif-
tung und der Anlaufstellen erfahren. Auf Bundesebene
und in Bayern ist bereits intensive Öffentlichkeitsarbeit
geleistet worden. Die Betroffenen zu erreichen, ist aber
schwierig. Genau so schwierig ist es, alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu erreichen, die in den vielen
Diensten und Einrichtungen der Sozialen Arbeit tätig
sind. Wir und das Sozialministerium haben das Ziel,
dass möglichst alle Betroffenen in Bayern rechtzeitig
von der Stiftung erfahren, damit sie dann entscheiden
MITTEILUNGSBLATT
03-2018
















