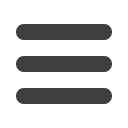
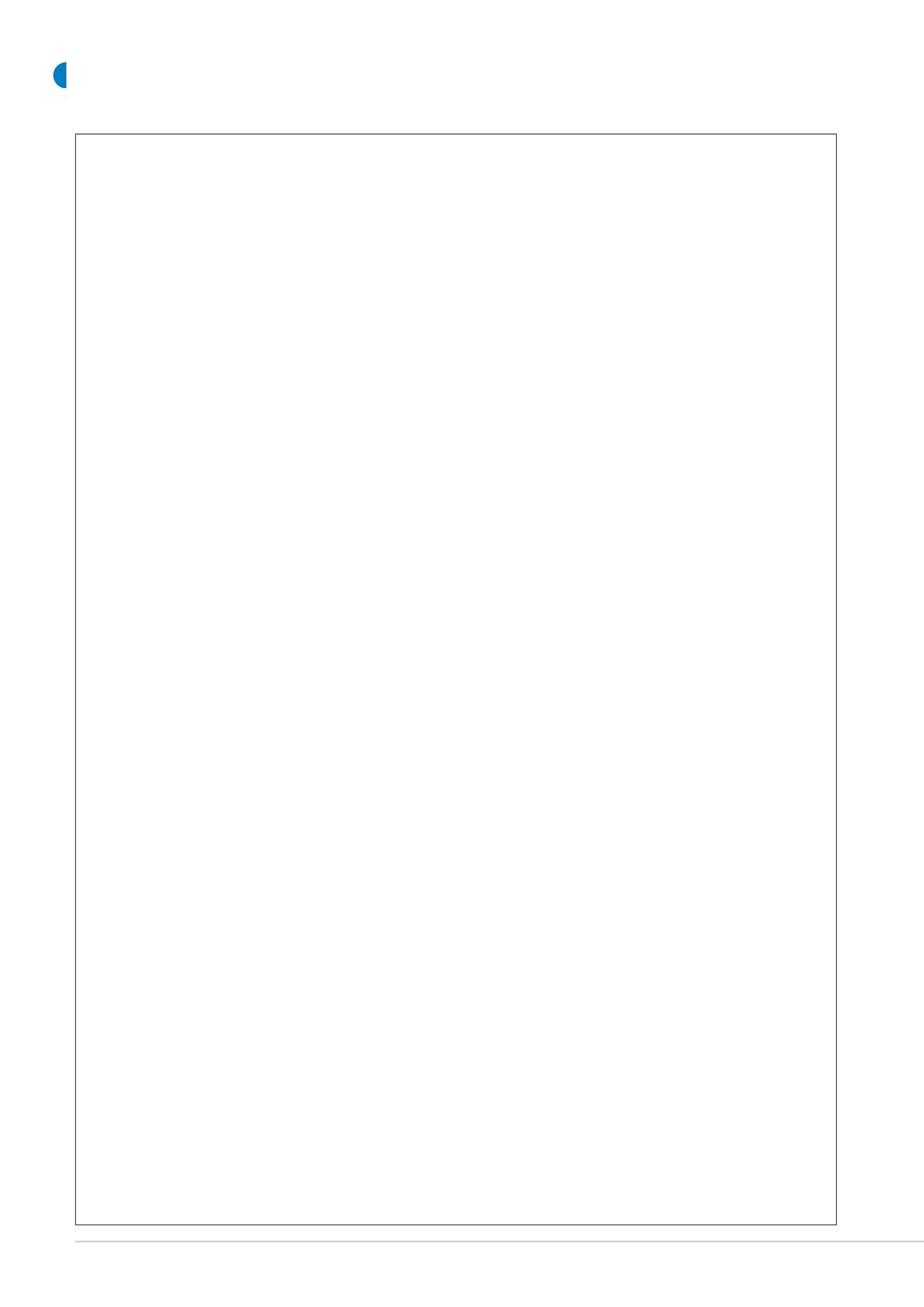
12
B E R I C H T E
zessen mit entsprechenden Angeboten können zudem Synergieeffekte geschaffen werden und so Ressourcen
innerhalb des Kinder- und Jugendhilfesystems geschont werden.
Die (infra-) strukturelle Verzahnung von Angeboten und Diensten sich wechselseitig bedingender und teils ex-
terner Organisationseinheiten gestaltet sich dann von Vorteil für die Adressatinnen und Adressaten, wenn sie
aufeinander abgestimmt sind und der reibungslose Austausch von einem gemeinsamen Interesse getragen
wird. Dieses gemeinsame Interesse kann beispielsweise in einem Beitrag zur Optimierung der jeweiligen Ange-
bote und Leistungen bestehen oder der kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Strukturen.
Sowohl die Träger der öffentlichen wie auch die Träger der freien Jugendhilfe verfügen hier prinzipiell über
das notwendige Knowhow und die dazugehörenden Ressourcen, um strukturelle Verzahnungen synergetisch
zu nutzen.
3.3 Handlungsfelder und Funktionsweisen
Zur organisatorischen und strukturellen Anbindung von ombudschaftlichen Tätigkeiten gehört die Beschrei-
bung möglicher Handlungsfelder genauso wie eine kontextbezogene Klärung der jeweiligen Funktionsweisen.
Dabei erscheint es zweckmäßig, die jeweiligen Regelungs- und Anpassungsbedarfe aus der Sicht der Adressa-
tinnen und Adressaten zu beschreiben und als Handlungsfelder für die Kinder- und Jugendhilfe zu definieren.
Diese können im Hinblick auf das sozialrechtliche Leistungsdreieck resultieren aus dem Verhältnis
• des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zu den Adressatinnen und Adressaten,
• der Träger der Jugendhilfe und ihrer Wechselwirkung in der Zusammenarbeit mit den Adressatinnen
und Adressaten,
• der Adressatinnen und Adressaten als Anspruchs- und Rechteinhaber gegenüber den Trägern der
öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie
• der unterschiedlichen Anspruchslagen von Personensorgeberechtigten und jungen Menschen.
Diese Auslegungssystematik bringt den Vorteil mit sich, dass weniger das Prinzip von „Ursache und Wirkung“
im Vordergrund steht, als vielmehr die Frage nach der erläuternden Funktionsweise des jeweiligen Wirkungs-
zusammenhangs. Die Tätigkeit einer ombudschaftlichen Vertretung könnte somit beschrieben werden, als eine
Identifizierung bestehender Konfliktlagen innerhalb bestehender Strukturen, verbunden mit einem unmittelba-
ren Handlungsansatz an den Problemlagen der Adressatinnen und Adressaten.
3.4 Abgrenzung gegenüber bestehenden Institutionen und Angeboten
Die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über ein vielfältig angelegtes Angebot von teils systemübergreifenden Ein-
richtungen, Diensten und Leistungen. Mit der Errichtung von ombudschaftlichen Vertretungen werden diese
wahrzunehmenden Aufgaben und Angebote in ihrer Gesamtheit und Funktionalität auf den Prüfstand ge-
bracht. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass bestehende Strukturen, z.B. gemäß § 81 SGB VIII, in Frage ge-
stellt oder in ihrer Funktionalität beschnitten werden. Sie müssen vielmehr dahingehend überprüft werden,
dass eine Ombudschaft entweder an die bestehenden Strukturen andocken kann oder aber die entsprechenden
Zugänge für die Adressatinnen und Adressaten ermöglicht.
Sofern bestehende Institutionen und Angebote bereits im ombudschaftlichen Sinne der Kinder- und Jugend-
hilfe agieren und einem Beteiligungs- und / oder Vermittlungsauftrag unmittelbar nachkommen oder diesen
mittelbar begünstigen (z.B. Heimaufsichten, Heimräte bzw. der Landesheimrat, Erziehungsberatungsstellen, Fa-
milienbüros, Jugendsozialarbeit an Schulen, Kinderbeauftragte und Familienstützpunkte), ist im Sinne der
Adressatinnen und Adressaten zu klären, ob und wie deren Auftrag gegebenenfalls zu konkretisieren ist, bzw.
ob weitere ombudschaftliche Funktionszuweisungen erfolgen müssen bzw. können. Gegebenenfalls muss aus
dem Blickwinkel der Kinder- und Jugendhilfe auch eine Abgrenzung gegenüber den Stellen erfolgen, die
rechtsystematisch andere Funktionsweisen erfüllen müssen (z.B. Schiedsstellen). Diese Abgrenzung muss sich
MITTEILUNGSBLATT
03-2018
















