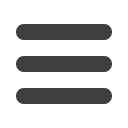
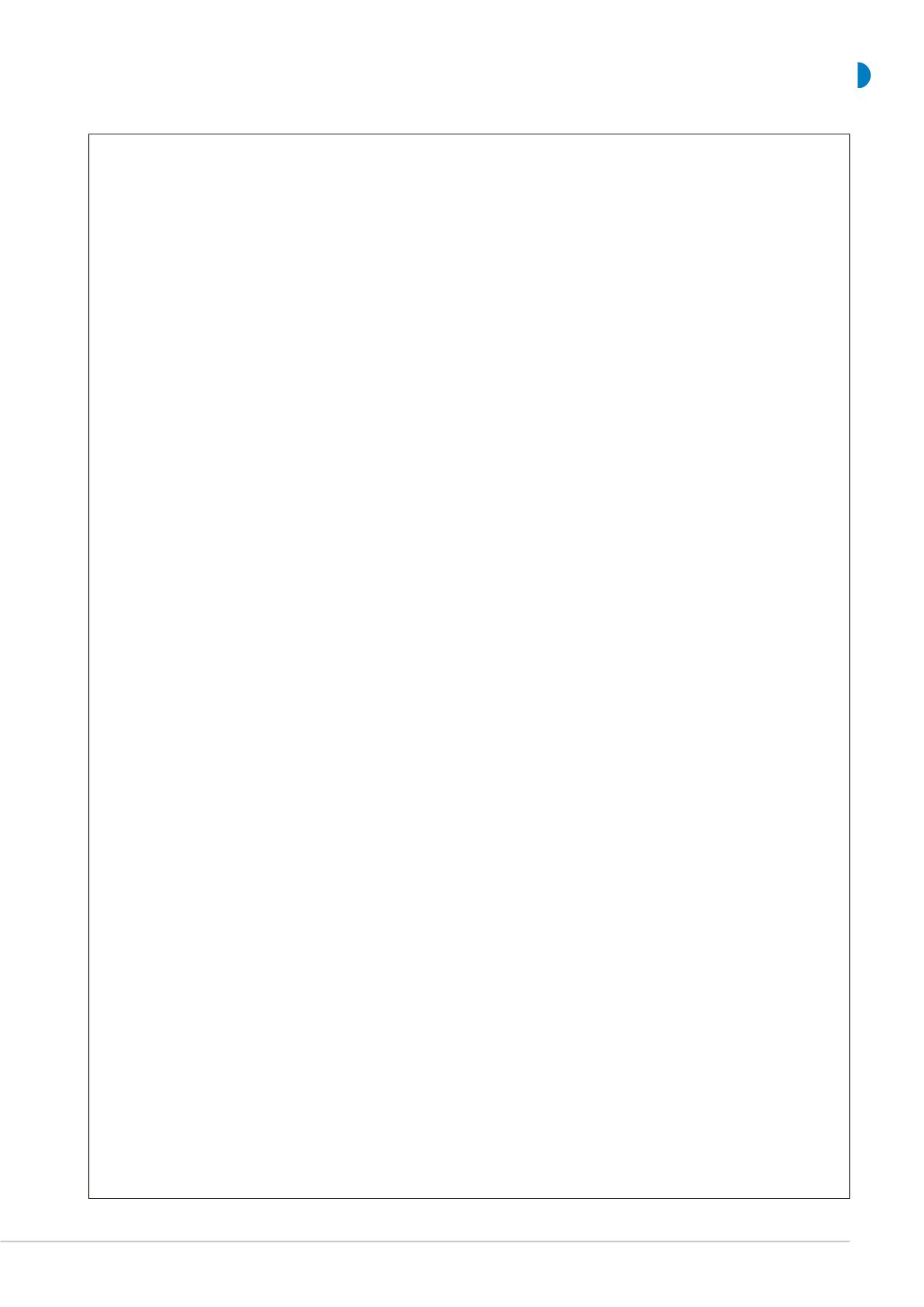
13
B E R I C H T E
ebenso auf diejenigen Hilfeleistungen beziehen, die teilweise von den (örtlichen) Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe miterbracht werden, sich aber nur bedingt für eine ombudschaftliche Vertretung eignen. Auszu-
schließen ist eine ombudschaftliche Vertretung bei Fragestellungen zum Kindergeld, bei Unterhaltsange-
legenheiten oder zum Bafög. Auszuschließen sind auch bestimmte Fragestellungen im familiengerichtlichen
Verfahren bei Trennung, Umgangsrecht und Scheidung sowie im jugendgerichtlichen Verfahren und der Ju-
gendarbeit.
3.5 Örtliche Anbindung
Ein Ombudschaftswesen in der Kinder- und Jugendhilfe setzt mit seinen Angeboten der Beratung, Beteiligung
und Begleitung sinnvollerweise dort an, wo die Adressatinnen und Adressaten ihren Lebensmittelpunkt haben,
bzw. dort, wo sozialräumliche Bezüge zu den auftretenden Problemfeldern bestehen. Dies bietet der ombud-
schaftlichen Vertretung den Vorteil einer ortsnahen Vernetzung. Im Sinne der Sozialraumorientierung sollten
ombudschaftlich arbeitende Dienste nach Möglichkeit dezentrale Strukturen vorhalten können bzw. die Adres-
satinnen und Adressaten „am Ort“ aufsuchen können.
4.
Rechtsbezüge eines Ombudschaftswesens
Weder Bundes- noch Landesgesetzgeber haben bislang eine gesetzliche Regelung als verlässliche Handlungs-
grundlage ombudschaftlichen Arbeitens erlassen.
Unabhängig davon haben die Adressatinnen und Adressaten eines Ombudschaftswesens Rechtsansprüche,
auf die im ombudschaftlichen Verfahren Bezug genommen werden kann.
Die ombudschaftliche Tätigkeit konzentriert sich hier insbesondere auf die Erläuterung rechtlicher Zusammen-
hänge und Verantwortlichkeiten zum Ausgleich unterschiedlicher Wissensstände der Beteiligten.
In diesem Kontext sind, abhängig von der Ansiedlung einer ombudschaftlichen Vertretung, Regelungen zur
Dienst-, Rechts- und Fachaufsicht sowie zur Weisungsbefugnis bzw. Weisungsungebundenheit zu treffen. All-
gemeingültige Aussagen können hierzu nicht getroffen werden, da die Bezüge zu stark voneinander abweichen
können.
Auch im ombudschaftlichen Verfahren sind die allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere der Schutz von Sozialdaten gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) sowie den spezialgesetzlichen
Regelungen der Sozialgesetzbücher I, VIII, IX und X zwingend einzuhalten. Konkret ist hierbei zu klären, ob,
welche und auf welchem Wege Sozialdaten von einer befassten Stelle zur anderen übertragen werden dürfen.
Hierzu ist ggf. in jedem Einzelfall eine schriftliche Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und -einsicht
von allen Adressatinnen und Adressaten erforderlich.
5.
Finanzierung
Die Sozialgesetzbücher enthalten differenzierte Bestimmungen über die Heranziehung von Eltern, anderen Per-
sonensorgeberechtigten und jungen Menschen an den Kosten sowie über die Förderung der Leistungserbrin-
ger bzw. einzelner Einrichtungen, Projekte oder Maßnahmen.
Charakteristisch für die rechtlichen Rahmenbedingungen der Finanzierungsformen ist ein Nebeneinander un-
terschiedlicher „Logiken“ zur Ausgestaltung der Finanzierung. Sofern ein öffentlicher Träger (Gemeinde, Land-
kreis, kreisfreie Stadt) eine Leistung selbst erbringt, gelten für deren Finanzierung die Maßgaben des
öffentlichen Haushaltsrechts unmittelbar. Die Kosten sind dementsprechend im Haushaltsplan der kommuna-
len Gebietskörperschaft zu veranschlagen und nach den Beschlüssen der Gremien der Gebietskörperschaft zu
bewirtschaften.
MITTEILUNGSBLATT
03-2018
















