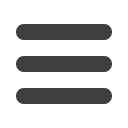

10
B E R I C H T E
sowie Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe entstehen, die zum Teil auf hierarchische Strukturen und Mach-
tasymmetrien zwischen verantwortenden und entscheidenden, ausführenden sowie leistungsempfangenden
Personen zurückzuführen sind. Ombudschaften tragen zur Klärung von Konflikten bei. Sie wirken deeskalierend
und helfen, empfundene Ohnmachten abzubauen. Gleichzeitig kann damit eine Erhöhung der Transparenz in
Entscheidungsprozessen erreicht werden. Wenn möglich, schaffen sie durch ihre Arbeit eine Stabilisierung und
Wiederherstellung des Vertrauens in der Beziehung von Adressatinnen und Adressaten der Hilfeleistungen
sowie den Entscheidungsträgern der Kinder- und Jugendhilfe und den jeweiligen Leistungserbringern.
1.4 Ombudschaft als Beitrag zum Beschwerde- und Fehlermanagement
Ombudschaften nehmen sich der Beschwerdeführenden wie auch der Beschwerden sachlich unterstützend
und wertschätzend an. Sie vermitteln unter Beachtung der rechtlichen Interventionsmöglichkeiten im Einzelfall
zwischen den Beteiligten.
Eine Rechtsberatung sowie eine aktive und anwaltliche Begleitung der Beschwerdeführerinnen und -führer im
Widerspruchs- und Klageverfahren durch die Ombudschaft erbringende Stelle sind von Rechts wegen ausge-
schlossen.
1.5 Ombudschaft als Beitrag zum Qualitätsmanagement
Unabhängig von der Beratung und Unterstützung der Anliegen im Beschwerdeverfahren leisten Ombudschaf-
ten einen Beitrag zur Professionalisierung, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Organisations- und
Verwaltungsablauf bzw. in Organisation und Ablauf der Leistungserbringung. Ihr Beitrag zu einem Beschwer-
de- und Fehlermanagement kann alle Beteiligten in der Aufarbeitung von kritischen Verfahrensverläufen unter-
stützen.
Ombudschaften, die als integrale Bestandteile von Organisationen im System der Kinder- und Jugendhilfe ge-
nutzt werden, können ggf. auch detaillierte Rückmeldungen dazu geben, wie die Angebote und Dienstleistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne der Adressatinnen und Adressaten zielgerichtet verbessert werden
können.
1.6 Ombudschaft als Beitrag zum Schnittstellenmanagement
Nicht alle Fragen von betroffenen und interessierten Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugend-
hilfe können durch eine Ombudschaft beantwortet und abschließend geklärt werden. Im gemeinsamen Dialog
entstehen immer wieder auch Bezüge zu anderen möglichen Unterstützungsleistungen und anderen Bezugs-
systemen. Hier können Ombudschaften als Vermittler und Lotsen fungieren und in die entsprechenden Sys-
teme vermitteln. So schaffen sie Orientierung im teils unübersichtlichen Leistungsgeflecht und können dazu
beitragen, dass die Adressatinnen und Adressaten ombudschaftlicher Angebote auch Zugänge in andere Be-
zugssysteme erhalten. Mögliche Exklusionsprozesse sollen dabei ausdrücklich vermieden werden.
2.
Gelingensfaktoren
Nachfolgend sollen diejenigen Faktoren eines Ombudschaftswesens in Bayern benannt werden, die strukturell
und verfahrensbezogen zu einer gelingenden Arbeit beitragen können.
2.1 Vermeidung von Parallelstrukturen
Abhängig von der Aufgaben- und Zielstellung eines Ombudschaftswesens in Bayern soll bei der kommunalen
und regionalen Verankerung im Kinder- und Jugendhilfesystem darauf geachtet werden, dass bestehende
Strukturen genutzt und – wenn nötig – kontextbezogen ergänzt werden.
MITTEILUNGSBLATT
03-2018
















