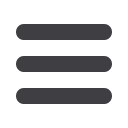

08
I N F O
Angebote zur Verselbständigung zu machen. In
diesem Zusammenhang sollen eine Wohnung zur
Verfügung gestellt, praktische Hilfen gewährt,
nach Bedarf unterschiedlich intensiv erzieherisch
beraten und betreut und der Lebensunterhalt si-
chergestellt werden (vgl. dazu Empfehlungen des
Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses vom
17.02.1993 zum Betreuten Wohnen im Rahmen
der Hilfe zur Erziehung, abgedruckt unter
http://www.blja.bayern.de/service/bibliothek/fachliche-empfehlungen/index.php.
2. Daneben gibt es einen zweiten, nicht minder be-
deutsamen Kritikpunkt am Beschluss des
BayVGH an der Auffassung zur Aufklärungsver-
pflichtung nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII.
Grundsätzlich dürfen Kostenbeiträge von unter-
haltspflichtigen Personen danach nur erhoben
werden, wenn den Pflichtigen die Leistungsge-
währung mitgeteilt und sie über die Folgen der
Leistungsgewährung für ihre zivilrechtliche
Unterhaltspflicht entsprechend umfänglich auf-
geklärt wurden.
Das Gericht ging wie eingangs dargestellt davon
aus, dass jede Änderung der Hilfeform innerhalb
der gleichbleibenden Hilfeart der vollstationären
Hilfe nach § 34 SGB VIII (z. B. Wechsel aus der
Heimeinrichtung in Betreutes Wohnen) jeweils
den Beginn einer neuen Jugendhilfemaßnahme
darstellt. Dabei sieht es als zwingende Voraus-
setzung an, dass Kostenbeitragspflichtige bei
jeder Änderung der vollstationären Hilfeform
erneut über die unterhaltsrechtlichen Folgen
einer Hilfegewährung aufzuklären seien.
Diese Auffassung steht in Konkurrenz sowohl zu
ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung (so
etwa BVerwG 5 C 56.01 vom 14.11.2002, BVerwG
5 C 25.10 vom 19.10.2011) wie auch zu einschlä-
gigen Kommentierungen in der Fachliteratur
(z. B. Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, 6. Auflage
2016, § 86 RdNr. 8). Danach ist grundsätzlich
nicht von einem neuen Leistungsbeginn auszu-
gehen, wenn aus pädagogischen Gründen ein
Wechsel zwischen Hilfearten im Sinne des § 34
SGB VIII stattfindet.
Der Beschluss des BayVGH steht der derzeitigen
Auslegungspraxis damit in mehrfacher Hinsicht ent-
gegen und kann im Ergebnis nur als völlig verun-
glückte Einzelfallentscheidung eingeordnet werden.
Eine praktische Umsetzung der Beschlussbegrün-
dung wird aus diesem Grund nicht empfohlen.
Klaus Müller
MITTEILUNGSBLATT
02-2017
1.1. Erkennungsdienstliche Behandlung
von unbegleiteten ausländischen Minder-
jährigen
Das StMAS weist in seinem AMS II5/6521-1/517 vom
23.11.2016 ausdrücklich darauf hin, dass eine lü-
ckenlose erkennungsdienstliche Erfassung aller un-
begleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA)
aus sicherheitspolitischen Gründen dringend erfor-
derlich ist.
Folgendes verbindliche Verfahren in Verantwortung
der Jugendämter wird vorgegeben:
B E R I C H T AU S D E R A R B E I T S G R U P P E K O S T E N UND Z U S T ÄND I G K E I T S F R AG E N
1. BETREUUNG UNBEGLEITETER
AUSLÄNDISCHER MINDERJÄHRIGER
- Grundsätzlich sollten UMA bereits bei der Ein-
reise durch die Bundespolizei bzw. das BAMF
registriert und erkennungsdienstliche Maßnah-
men durchgeführt werden. Damit ist sicherzu-
stellen, dass von Anfang an eine AZR-Nummer
(verbindliche Registrierungsnummer im Auslän-
der-Zentralregister) vorliegt.
- Sollte ein UMA im Einzelfall ohne Registrierung
und erkennungsdienstliche Erfassung beim Ju-
gendamt ankommen, so soll dieser umgehend an
eine Dienststelle der Landespolizei mit der Bitte









