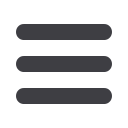
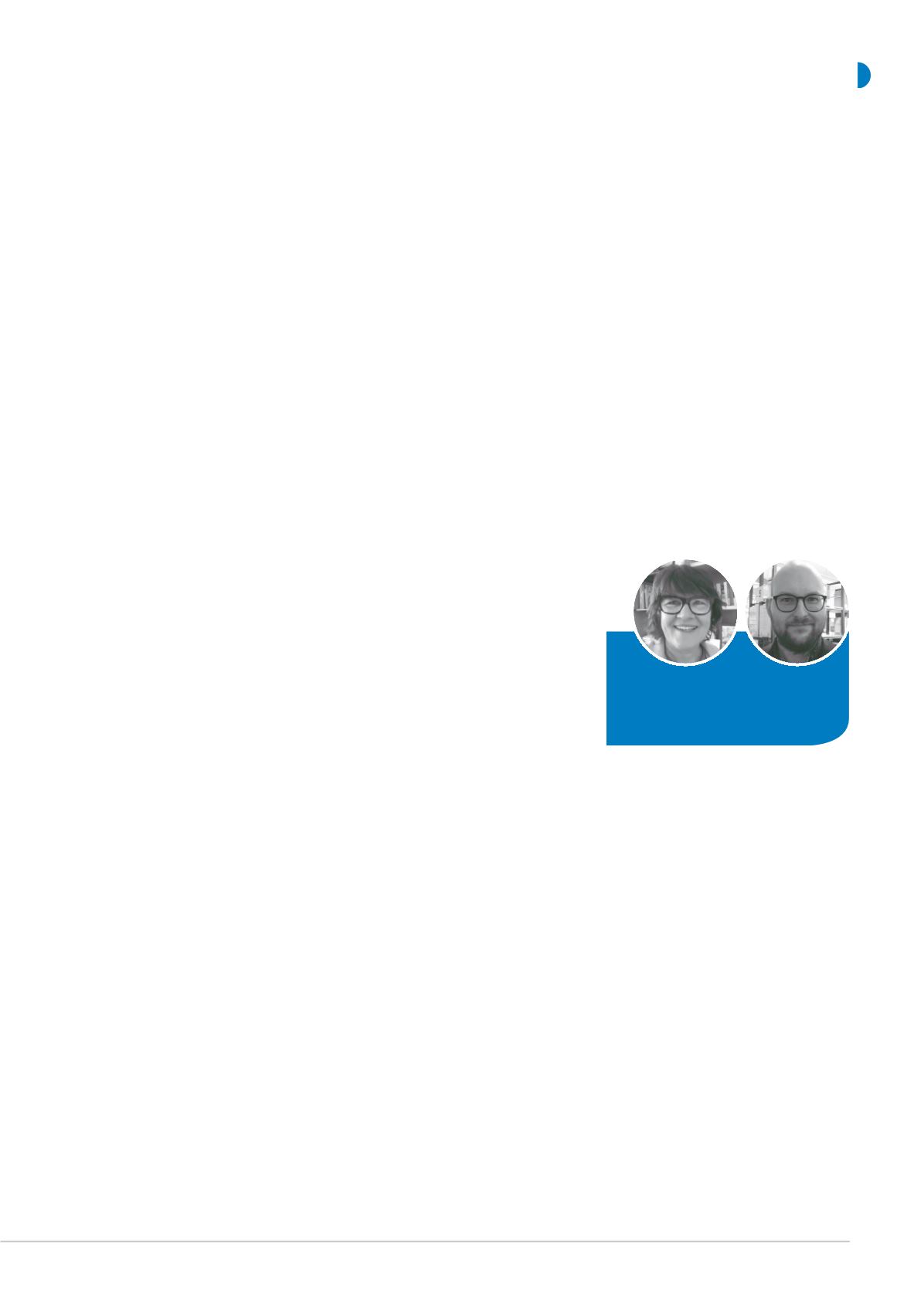
13
T H EMA
gung IPSHEIM und im LHR werden dieselben Jugendli-
chen dann, wie oben geschildert, auf dem nächsthöhe-
ren Level befähigt und bilden sich wiederum weiter.
Die Heime sind somit Basis, zentrale Dreh- und Angel-
punkte und Befähigungsorte für diesen Prozess, der es
Heimjugendlichen ermöglicht, sich zuständig für die ei-
genen Belange zu fühlen und zu AkteurInnen in Sachen
Beteiligung zu werden. Hier entwickeln Jugendliche in
der Gemeinschaft Kompetenzen, um sich konstruktiv
streiten zu können, eigene Interessen zu vertreten, sich
in andere hineinzuversetzen und es aushalten zu kön-
nen, wenn man sich nicht durchsetzen kann.
Der Befähigungsprozess, der es Heimjugendlichen er-
möglicht, als selbstständige und selbstbewusste Ak-
teurInnen für ihre Rechte einzutreten und an Entschei-
dungsprozessen mitzuwirken, und der am Ende im
hochmotivierten und politisierten LHR-Jugendlichen
mündet, beginnt auf der Ebene der einzelnen bayeri-
schen Heimeinrichtung. Es liegt somit in der Verant-
wortung der Heime, über eine gelebte Beteiligungs-
kultur und professionelles Engagement letztlich auch
die Arbeit des LHR Bayern zu ermöglichen.
5.5. Heimjugendliche sehen einen hohen Bedarf für
Beschwerdemöglichkeiten, externe Beschwer-
demöglichkeiten fehlen in bayerischen Heimen
Für die Heimjugendlichen ist das Vorhandensein von
Beschwerdemöglichkeiten von zentraler Bedeutung.
Sie wird von den Jugendlichen als Aufgabe des LHR
und der Heimräte mit höchster Priorität nachgefragt.
Die Nachfrage nach Beschwerdestellen ist so heraus-
stechend hoch, dass vermutlich davon ausgegangen
werden kann, dass aktuell vorhandene Beschwerde-
stellen von den Jugendlichen als nicht ausreichend
wahrgenommen werden. Die Jugendlichen geben
zudem an, sich bei Beschwerden fast ausschließlich
heimintern oder im System der Jugendhilfe (Jugend-
amt) äußern zu können.
Wie sich hier die Zusammenhänge gestalten und ob
solche Zusammenhänge existieren, kann die vorlie-
gende Studie an dieser Stelle nicht beantworten, hier
besteht weiterer Forschungsbedarf. Dass eine externe
Beschwerdestelle (wie etwa eine Ombudsstelle) hier
eine Bedarfslücke schließen würde und für die befrag-
ten Heimjugendlichen die Frage nach Beschwerde-
möglichkeiten von zentraler Bedeutung ist, kann an
dieser Stelle aber bereits festgehalten werden.
Für diese Kurzfassung der Studie verwendete Literatur
Bayerisches Landesamt für Statistik (2016): Kinder- und
Jugendhilfe in Bayern 2015; Ergebnisse zu Teil I: Erzie-
herische Hilfen und Ergebnisse zu Teil IV: Ausgaben
und Einnahmen. Fürth.
Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse.
Grundlagen und Techniken. 11., aktualisierte und über-
arb. Aufl. Weinheim: Beltz.
Sierwald, Wolfgang (2008): „Gelingende Beteiligung
im Heimalltag“. Eine repräsentative Erhebung bei
Heimjugendlichen. In: Dialog Erziehungshilfe, H. 2/3,
S. 35 – 38.
Wolff, Mechthild; Hartig, Sabine (2013): Gelingende Be-
teiligung in der Heimerziehung. Ein Werkbuch für Ju-
gendliche und ihre BetreuerInnen. Weinheim: Beltz
Juventa.
Autorin & Autor
Prof. Dr. Mechthild Wolff, Dozentin für erziehungswis-
senschaftliche Aspekte Sozialer Arbeit an der Hoch-
schule Landshut; Studiengangsleiterin des
BA-Studiengangs Soziale Arbeit in der Kinder- und Ju-
gendhilfe.
Jan Thomas van Calker, Student im 7. Semester des
Studiengangs Soziale Arbeit in der Kinder- und Ju-
gendhilfe an der Hochschule Landshut.
Kontakt:
Hochschule Landshut, Fakultät für Soziale Ar-
beit, Am Lurzenhof 1, Tel. 0871 506439, 84036 Lands-
hut, E-Mail:
mwolff@haw-landshut.deMITTEILUNGSBLATT
04-2017
J A N T H O M A S
V A N C A L K E R
M E C H T H I L D
W O L F F


















